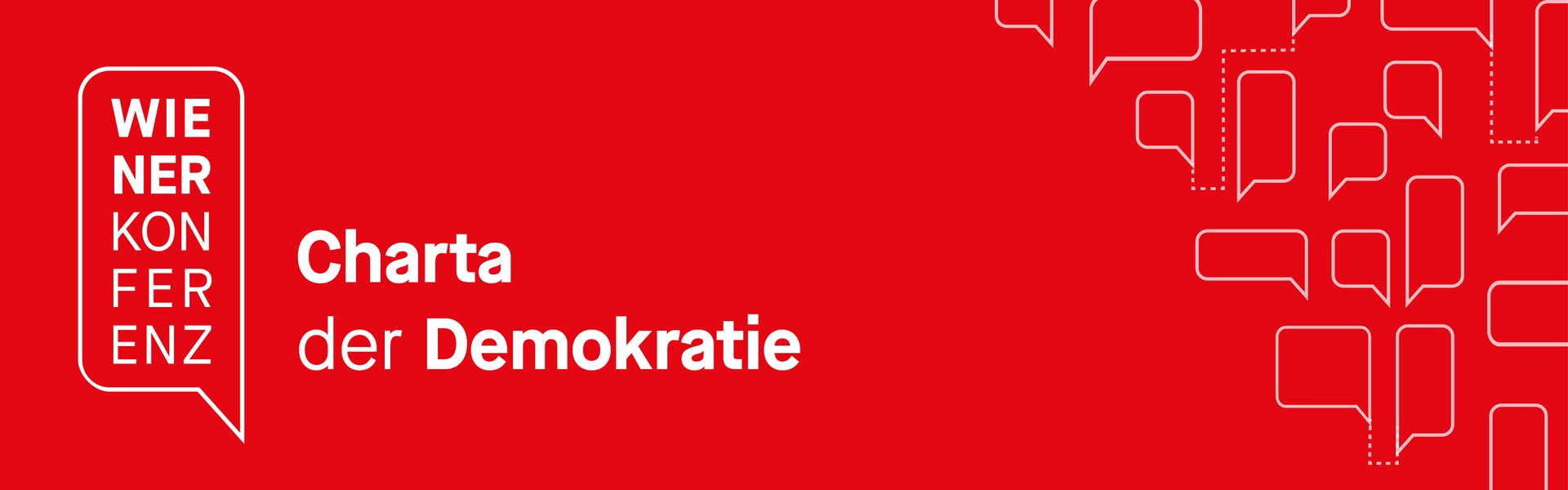
Die Sozialdemokratie ist die einzige politische Kraft in Österreich, die das Wort „Demokratie“ in ihrem Namen trägt. Das hat einen Grund. Die Stärkung demokratischer Teilhabe ist eine zentrale politische Mission der Sozialdemokratie. Der politische Kampf unserer Bewegung war und ist ein Kampf für eine gerechte Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der alle Menschen frei und gleich an Würde geboren sind und ohne Unterschied das Recht auf ein selbstbestimmtes und gutes Leben haben. Dazu wollen wir sie er-mächtigen.
Deshalb war und ist der Platz von uns Sozialdemokrat*innen auch immer an der Seite der Unterdrück-ten. Unsere Stimmen sind laut für die Leisen, unsere Solidarität stark für die Benachteiligten und deshalb ist unsere politische Kraft die Kraft der Vielen. Als Sozialdemokratie haben wir uns in jeder historischen Phase gegen Faschismus und Autokratie gestellt und uns für die demokratische Republik eingesetzt.
Wir haben das allgemeine Wahlrecht und das Frauenwahlrecht erkämpft, die Interessenvertretung der Arbeiter*innen und Angestellten und die Selbstverwaltung, um die medizinische Versorgung für die arbeitenden Menschen zu sichern. Und vom Roten Wien bis heute ist es unser Selbstverständnis, dass der Kampf für politische Gleichheit und der Kampf für soziale Gleichheit zusammengehört.
Wir sind nicht blind für Klassenverhältnisse, für ökonomische Ungleichheit, patriarchale Machtstrukturen und Diskriminierung. Wir kämpfen dagegen an, denn unser Gesellschaftsbild ist eine Solidargemeinschaft und geht nicht vom Recht des Stärkeren aus. Wir setzen uns ein für einen starken Sozialstaat, gleichen Zugang zur Bildung und leistbarem Wohnen, faire Löhne und gerechte Arbeitsverhältnisse. Wir machen uns stark für Kinderrechte und eine umfassende Gleichstellung von Frauen und LGBTIQ-Personen. Unser Einsatz für die Vielen ist untrennbar verbunden mit dem Einsatz für politische Mitbestimmung dieser Vielen in Grätzl, Stadt und Staat.
Wir Sozialdemokrat*innen sind das Herz der Demokratisierung. Wien ist ein Zentrum sozialdemokratischer Politik, weshalb wir hier die soziale Demokratie stärken und weiterentwickeln wollen. Denn wir Wiener*innen erleben tagtäglich, wie sehr unser sozialer
Zusammenhalt, unsere Demokratie und damit unser aller Zukunft in Frage gestellt werden.
Die Zeit, in der wir leben, kann und muss wohl als Zeit der Krisen beschrieben werden. Die Coronakrise hat wie ein Brennglas Ungleichheit und Ungerechtig-keiten offengelegt und verstärkt. Auch die grassie-rende Teuerung, die globale Energiekrise und eine drohende Rezession zeigen klar, dass die soziale Frage jetzt gestellt werden muss. Während einige Privilegierte von alldem kaum etwas spüren, weiter ihren Wohlstand vermehren und sogar Übergewinne kassieren, verlieren immer mehr Menschen den Bo-den unter den Füßen. Armut wird plötzlich eine reale, akute Gefahr für viele.
Es sind diese Vielen, die Tag für Tag hart für sich, ihre Familien und die Gesellschaft arbeiten, deren Leben stark unter Druck gerät – im Gegensatz zu je-nen Wenigen, die noch immer andere für ihr Geld ar-beiten lassen können und schamlos von dem Leid anderer sogar noch profitieren.
Es sind Kinder und Jugendliche, die finanzielle Eng-pässe und Armut unmittelbar und täglich zu spüren bekommen und deren Zukunft insbesondere durch die Klimakrise auf dem Spiel steht. Es sind Frauen, die besonders stark von den negativen Auswirkun-gen von Krisen getroffen sind, und die dennoch (oft unbezahlt) gesellschaftliches Überleben und Zusam-menhalt sichern. Es sind die wirklichen Leistungsträ-ger*innen, die Wien am Laufen halten. Sie sind die Stützen unserer Gesellschaft, die uns Stabilität ge-ben. Wer an ihnen sägt, bringt uns alle zu Fall. Das können wir nur durch mehr Demokratie verhindern. Die Stimmen der Vielen müssen auf allen Ebenen ge-hört werden. Denn ein gefährliches Resultat der an-dauernden Krisen ist eine gefühlte Ohnmacht – denn Viele sind von demokratischer Mitgestaltung ausge-schlossen, vor allem aufgrund ihrer Herkunft.
Je leiser die Stimmen der Vielen sind, desto lauter sind jene der Feind*innen der Demokratie. Nationalismus und der Ruf nach „starken Männern“ gefährden unsere Gemeinschaft ebenso wie eine rechte Politik der Angst, die die Suche nach Sündenböcken der Suche nach Lösungen für die Probleme unserer Zeit vorzieht. Wir erleben es jetzt gerade. Aufgrund der Teuerung breiten sich reale soziale Abstiegsängste rasant aus – und sofort sind autoritäre Kräfte zur Stelle, die solche Ängste ausnützen, um ihre antidemokratische Agenda voranzubringen.
Sie zersetzen das Vertrauen in die konstruktive Kraft der Demokratie. Sie stellen das Schüren von Hass und Neid und die Spaltung der Arbeitnehmer*innen an die Stelle eines Kampfs für mehr Gerechtigkeit. Und das Sittenbild einer Reihe von Minister*innen und Kanzlern, die Populismus, Käuflichkeit oder schlicht politische Unfähigkeit an den Tag legt, hat das Vertrauen in redliche, rechtsstaatliche und lösungsorientierte Politik im Dienste der Menschen zusätzlich stark untergraben.
Es ist auch das Gefühl der Vielen, nicht gehört oder repräsentiert zu werden. Um für mehr Gerechtigkeit, weniger Hürden, höhere Löhne, kurz: ein besseres Leben zu kämpfen, braucht es aber das genaue Ge-genteil: Die Stimmen der Vielen, unserer Demokratie. Wir, nicht ich. Darum wollen wir alle Lebensbereiche mit Demokratie fluten, wie es schon Bruno Kreisky formulierte.
Dass ein Drittel aller Wiener*innen im wahlfähigen Alter bei Wahlen nicht mitbestimmen kann, weil sie keine österreichische Staatsbürger*innenschaft haben, obwohl sie seit Jahren hier leben oder hier geboren sind, ist ein solches Demokratiedefizit. In einzelnen Grätzln oder Bezirken ist dieses Defizit noch deutlich höher. Wir setzen uns deshalb für ein modernes Staatsbürger*innenschaftsrecht ein, denn wer hier lebt, soll auch mitbestimmen können.
Die Schieflage der Demokratie wird noch krasser sichtbar, wenn wir die Klassenfrage stellen. In Wien stellen Arbeiter*innen die größte Gruppe der nicht Wahlberechtigten, bei prekären Berufen ist diese Tendenz nochmals extremer. Diese Ungerechtigkeit geht Hand in Hand mit den hohen finanziellen Hürden zur Erlangung der Staatsbürger*innenschaft und da-mit des Wahlrechts.
Unsere Demokratie darf nicht Privilegierten vorbehalten sein. Jede Stimme muss gleich viel zählen. Das Risiko einer politischen Ungleichheit wird heute, im Angesicht einer massiven Teuerung und damit einer rasant steigenden Armutsbedrohung, zur brüchigsten Schwachstelle unserer Gesellschaft. Hier müssen wir anpacken, wenn wir auch morgen noch in einer Demokratie leben wollen.
Als Bewegung der Arbeitnehmer*innen stehen wir an der Seite jener, die Wien Ziegel für Ziegel aufgebaut haben und es Tag für Tag am Laufen halten. Deshalb ist für uns die Ausweitung sozialer Demokratie in der Arbeitswelt entlang sozialer und ökonomischer Gleichheit ein Auftrag.
Unser Fokus liegt auch und besonders auf jungen Wiener*innen. Kinder und Jugendliche haben das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben, auf Mitsprache und auf eine gute Zukunft. Doch viele haben keinen österreichischen Pass und damit keine Mitsprache bei Wahlen. Sie wachsen in unserer Stadt auf, ohne demokratische Mitbestimmung erleben und er-lernen zu können. Das schadet dem sozialen Zusammenhalt und den jungen Menschen. Mehr Demokratie bedeutet für uns auch, gegen Kinder- und Jugendarmut, für mehr Chancen am Arbeitsmarkt, mehr Beteiligung und Respekt für die Jungen und für Bildungsgerechtigkeit einzutreten.
Demokratie hört aber nicht beim Zugang zu Wahlen auf. Wir wollen demokratische Strukturen insgesamt erneuern und erweitern. Wir setzen auf neue Beteiligungsformate, auf Mitbestimmung im Grätzl, in der Arbeitswelt und in städtischen Planungsprozessen. Dabei sollen vor allem die Vielen gehört werden, die ständig überschrien werden. Die ständig an den Rand gedrängt werden. Die niemand zu sehen scheint.
Wir richten gezielt die Scheinwerfer auf sie, bieten ihnen Bühnen und geben ihnen Megafone in die Hand, um sich selbstwirksam Gehör zu verschaffen und sich stark zu machen für die Besserstellung ihrer Lebensrealitäten.
Wien ist eine Stadt der Demokratie und Menschen-rechte, in der jede Wienerin und jeder Wiener gesehen, gefragt und gehört wird – unabhängig von Alter, Bildungsgrad, Lebensweise und sozialer Situation. Und wir lassen niemanden zurück: Unser Wiener Sicherheitsnetz fängt alle auf, egal, woher man kommt – aktuell etwa bei der Unterstützung in der Energiekrise.
Weil alle Menschen es verdienen, in Würde und selbstbestimmt zu leben. Das geht uns alle etwas an. Denn zusammen sind wir Wien.

Wir wollen nicht Spielball anderer Kräfte sein, sondern unser Leben in die Hand nehmen. Wo Menschen sich sicher sein können, dass ihre Anliegen gehört werden, leben sie gern und in Frieden mit anderen. Wer gemeinsam für etwas kämpft, lernt Selbstwirksamkeit und übernimmt Verantwortung. Man erkennt, dass man nicht allein ist, sondern erlebt Gemeinschaft. Das bedeutet: Unser Zusammenleben wird umso besser, je mehr von uns mitreden können.
Das zeigt sich in vielen Formen.
Auf der höchsten Ebene politischer Machtverhältnisse sind es demokratische, freie und faire Wahlen. Doch auch in anderen Bereichen unseres Zusammenlebens müssen Menschen mitgestalten können. Im Fall des Europäischen Parlaments können Österreicher*innen sogar über die Landesgrenzen hinaus die Gesetzgebung beeinflussen (selbst wenn diesem Parlament weiterhin das entscheidende Recht zur Gesetzes-Initiative fehlt).
Instrumente der direkten Demokratie wie Petitionen oder Volksbegehren ermöglichen uns, selbst aktiv zu werden und sich zu bestimmten Themen Gehör zu verschaffen – abseits der Wahltermine.
Bei der Arbeit – egal ob Anstellung, Selbstständigkeit oder unbezahlte Care-Arbeit – gelten Regeln. Diese müssen von jenen formuliert werden, die Arbeit leisten. Daher bildeten sich Betriebsräte und Gewerkschaften. Erst als sich arbeitende Menschen organisierten, erkämpften sie eine menschenwürdige Wirtschaftswelt – nicht nur für sich, sondern in Solidarität mit allen Arbeiter*innen.
Auf kommunaler Ebene, im direkten Wohn- und Lebensumfeld, wird laufend über den Alltag der Menschen entschieden. Freizeitflächen, Verkehrslenkung, Projekte zu Integration oder Umweltschutz: All das betrifft die Menschen direkt und muss daher von ihnen mitbestimmt werden. Nur so ermöglichen wir gutes Leben.
Die Stadt Wien nutzt bereits verschiedene Wege, Menschen auf kommunaler Ebene einzubinden. Wiener Stadtentwicklung hat eine starke partizipative Tradition: Die Menschen vor Ort kennen ihre Lebensräume am besten und leisten daher einen wertvollen Beitrag zur Gestaltung.
Schon 2012 veröffentlichte die Stadt Wien das „Praxisbuch Partizipation“ für
Stadtentwicklung, um die Einbindung der Bewohner*innen zu fördern. Seither gehen wir in Wien kontinuierlich neue und innovative Wege im Bereich Beteiligung. Denn Demokratie passiert nicht nur am Wahltermin, sondern auch dazwischen. Demokratie und Beteiligung sind Übungssache. Es ist wichtig, auch jenen, die vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder bisher wenig mit Beteiligungsprojekten in Berührung kamen, Werkzeuge in die Hand zu geben, um ihrer Stimme Gehör zu verschaffen.
Heute nimmt das unterschiedlichste Formen an:
Mit der „Werkstadt Junges Wien“ wurde 2018 ein umfassendes Mitmachprojekt für Kinder und Jugendliche gestartet. In über 1.300 Workshops haben 22.000 Kinder und Jugendliche uns gesagt, was sie an der Stadt lieben und welche Idee sie für Wien haben. Daraus entstanden die erste Wiener Kinder- und Jugendstrategie, das wienweite Kinder- und Jugendparlament sowie erstmals ein partizipatives Budget von einer Million Euro pro Jahr.
Mit den Wiener Klimateams gehen wir einen neuen innovativen Weg zu einer nachhaltigeren Stadt. Die Verwaltung erarbeitet gemeinsam mit den Bürger*innen Ideen zu innovativen Projekten, die eine positive Klimawirkung haben. Welche umgesetzt werden, entscheidet eine Bürger*innenjury.
Die Initiative „Gebietsbetreuung Stadterneuerung“ lädt ein, bei Sanierungs- und Begrünungsprojekten mitzugestalten. Die Lokale Agenda 21, unterstützt von der Stadt Wien, schafft laufend neue Projekte zur Einbindung der Bürger*innen in die Stadtentwicklung. Mit den Grätzloasen werden „Parklets“ gefördert, die Lebens- und Gestaltungsraum im direkten Lebensumfeld bieten. Mit dem „Jungen Grätzl“ gedeihen in den Bezirken immer mehr Projekte, bei denen Kinder direkt vor Ort mit Kindern ihr Umfeld gestalten.
Weiters haben einige Bezirke partizipative Budgets beschlossen, über deren Verwendung Bürger*innen direkt abstimmen können. Dazu kommen zahlreiche einmalige projektbezogene Partizipationsprozesse auf allen Ebenen der Stadt.
Solche Mitgestaltung in diesen und anderen Bereichen ist eine Frage der Gerechtigkeit, ein menschliches Grundbedürfnis und ein Gebot der Demokratie. Dabei werden Menschen gestärkt, lernen mehr über die Bedürfnisse anderer und entwickeln Lösungen, von denen alle etwas haben. Anspruch eines modernen Staates muss es sein, dieses Grundbedürfnis zu erfüllen. Er muss Möglichkeiten zur Mitgestaltung fördern und Menschen – besonders jene, die am meisten von bestehenden Verhältnissen unterdrückt werden – dazu ermächtigen, diese Möglichkeiten zu nutzen.
Diesem Anspruch wird der österreichische Staat heute nicht gerecht.
Selbst wenn theoretisch die Möglichkeiten dazu bestehen – wenn etwa freie und faire Wahlen abgehalten werden, Gewerkschaften aktiv sind und Anrainer*innen zu kommunalpolitischen Fragen befragt werden – bleiben strukturelle Hürden, die bestimmte Gruppen ausschließen.
Wir gehen in Wien mit gutem Beispiel voran, um die Wiener*innen noch stärker in die Stadtentwicklung und die Gestaltung ihrer eigenen unmittelbaren Lebensräume einzubinden.
Forderungen: Mehr Mitbestimmung in Arbeit und Wirtschaft

Arbeit und Partizipation gehen Hand in Hand. Wer Arbeit leistet, muss mitbestimmen, unter welchen Bedingungen sie geleistet wird. Gewerkschaften und Betriebsrät*innen sind die Wächter*innen dieser Teilhabe. Im ÖGB sind aktuell etwa 1,2 Millionen Arbeiter*innen organisiert, seit 2010 gab es ein konstantes Wachstum – erst das Corona-Jahr 2020 brachte einen einmaligen Rückgang in absoluten Zahlen, wegen Kündigungen und Betriebsschließungen[1]. Österreichs starke Gewerkschaften sind also positive Beispiele einer partizipativen Gesellschaft. Sie haben diversen Angriffen wirtschaftsliberaler Regierungen standgehalten, bewahren das politische Gewicht der Arbeiter*innen und zeigen besonders heute ihren unschätzbaren Wert.
Was allerdings die politische Mitsprache der Arbeiter*innen drastisch schwächt, ist der immens hohe Anteil an Nicht-Wahlberechtigten: Österreichweit werden 21 Prozent der unselbstständig Beschäftigten vom allgemeinen Wahlrecht ausgeschlossen, bei Arbeiter*innen sind es 28 Prozent – in Wien sogar 60 Prozent. Unter den Hilfsarbeiter*innen können 82 Prozent nicht wählen[2]. Das sind Menschen, die hier Arbeit leisten und unsere Wirtschaft am Laufen halten. Mitbestimmen dürfen sie trotzdem nicht, weil die Erlangung der Staatsbürger*innenschaft an Bedingungen geknüpft wird, die Wohlhabende bevorteilt. Das verschiebt die politischen Machtverhältnisse weg von Arbeiter*innen.
Und auch hier sind Frauen überproportional benachteiligt. Ein großer Teil der Arbeit wird in Österreich unbezahlt geleistet. Es sind meist Frauen, die Kinder betreuen und Angehörige pflegen[3]. Diese Arbeiterinnen sind nicht gewerkschaftlich organisiert und haben daher keine Stimme bei Verhandlungen um Arbeitsbedingungen, obwohl sie selbst davon betroffen sind. Denn der Umstand, dass Care-Arbeit unbezahlt und unreglementiert ist, ist eine politische Entscheidung, und müsste anders organisiert werden. Im jetzigen Zustand wird Frauen der Zugang zu einer essenziellen Form der Mitsprache blockiert.
Auch bei Unternehmer*innen wird vielen Partizipation verwehrt. Bei Wahlen der Wirtschaftskammer dürfen zwar alle Personen mit Gewerbeschein wählen – kandidieren dürfen aber nur österreichische Staatsbürger*innen oder Personen mit Staatsbürger*innenschaft aus der EU, dem Europäischen Wirtschaftsraum oder einem Staat, der ein entsprechendes Abkommen mit Österreich abgeschlossen hat. Solche Abkommen fehlen etwa mit den Vereinigten Staaten von Amerika, China, dem Iran und Afghanistan. In der Praxis bedeutet das: Wer zufällig aus einem solchen Staat kommt, darf sich in der Wirtschaftskammer nicht einbringen.
Am Arbeitsmarkt stark eingeschränkt werden außerdem Menschen nicht-österreichischer Herkunft, deren im Ausland erworbene Qualifikationen hier nicht anerkannt werden. Wie bei Staatsbürger*innenschafts-Anträgen hängen damit hohe Kosten zusammen, um etwa Dokumente übersetzen oder beglaubigen zu lassen. Obwohl der Prozess gesetzlich maximal vier Monate dauern darf, kann er sich auf einen wesentlich längeren Zeitraum erstrecken – von bis zu zwei Jahren berichten Medien[4]. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist das ein unhaltbarer Zustand, der unserer Wirtschaft schadet und desintegrativ wirkt.
[1] ÖGB (2021)
[2] Jahoda-Bauer-Institut (2022)
[3] Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (2022)
[4] Derstandard.at, „Anerkennungen: Der lange Weg zur Berufsausübung“ (Online: 24.10.2022)

Die Zukunft unserer Demokratie ist eine aktive, engagierte und politische Jugend. Doch das Vertrauen junger Menschen in die Politik ist alarmierend gering. Nur sechs Prozent fühlen sich von der Politik „gut vertreten“, über ein Drittel denkt, dass sich die Politik nicht für sie interessiert.[1]
Sie merken, dass sie nicht mitbestimmen dürfen. Das zeigen auch die Zahlen. In Wien dürfen 72.000 Personen zwischen 16 und 24 Jahren aufgrund ihrer Herkunft nicht wählen[2]. Sie leben hier oft seit ihrer Geburt, sind Wiener*innen durch und durch, haben aber keine Mitsprache bei den Machtverhältnissen.
Junge Menschen hätten allen Grund, Gehör einzufordern. Bei der Pandemiebekämpfung wurde ihnen viel abverlangt. Sie verzichteten auf wertvolle Jahre an der Schule oder in der Universität, auf neue Begegnungen mit Menschen in derselben Lebensphase. Seit der Anfangsphase der Pandemie kämpft etwa die Hälfte der Schüler*innen mit psychischen Problemen[3]; bis heute fehlen effektive Hilfsmaßnahmen. Dazu kommt die Sorge vor den Folgen des Klimawandels auf ihre Zukunft.
Tatsächlich erleben wir, dass sie ihre Stimme erheben. Besonders an den Bewegungen Fridays for Future und Black Lives Matter sehen wir, dass junge Menschen auf die Straße gehen, um gegen Ungerechtigkeiten und für eine bessere Zukunft zu kämpfen.
Es ist unsere Aufgabe, ihnen Mitgestaltung zu ermöglichen. Das fängt bei der Ausbildung an und muss sich durch den ganzen Alltag ziehen. Wir müssen jungen Menschen die Rahmenbedingungen geben, damit ihre Teilhabe im demokratischen Prozess verstärkt wird. So schaffen wir die nächste Generation von Demokrat*innen.
In der Stadt Wien gibt es schon Vorreiterprojekte, etwa die Jugendparlamente: Hier entscheiden Jugendliche gemeinsam über ein Budget und setzen konkrete Projekte um. Ihr direktes Lebensumfeld gestalten sie bei der Initiative „Junges Grätzl“ aktiv mit. In der „Werkstadt Junges Wien“ arbeiteten Kinder und Jugendliche in über 1.300 Workshops an der städtischen Kinder- und Jugendstrategie mit.
Abgesehen von solchen Projekten braucht es strukturelle Reformen. Politische Bildung und Medienkompetenz müssen in die Lehrpläne, damit die Erfüllung der Schulpflicht auch die Befähigung zur mündigen politischen Mitgestaltung bedeutet. Mitbestimmung an Schulen und Universitäten muss neu belebt werden.
Und damit junge Menschen ihre Zukunft auch an der höchsten Machtebene mitgestalten können, muss ihnen die Einbürgerung und damit die Erlangung des Wahlrechts erleichtert werden. Zusätzlich braucht es soziale und materielle Voraussetzungen: Psychosoziale Stabilität ist eine Grundvoraussetzung für Teilhabe.
[1] SORA (2022)
[2] orf.at, „Fast ein Drittel der Wiener darf nicht wählen“ (Online: 24.10.2022)
[3] Donau-Universität Krems (2021)

Die liberale Demokratie beruht auf drei voneinander getrennten Gewalten: Legislative, Exekutive und Judikative. Dies soll dafür sorgen, dass sie sich gegenseitig in einem System der Checks and Balances die Waage halten und Machtmissbrauch verhindern.
Zu diesen drei Säulen kommt eine vierte, informelle: Freie Medien. Sie sollen in einer Demokratie zum freiheitlich-demokratischen Diskurs beitragen und eine zusätzliche Kontrolle der drei Gewalten gewährleisten. Voraussetzung dafür ist auch, dass Journalist*innen unabhängig arbeiten können – dafür braucht es starke Redaktionsstatuten.
In unserem Land wird diese Rolle sowohl von öffentlich-rechtlichen, als auch von privaten und nicht-kommerziellen Medien wahrgenommen. Dabei ist es wichtig, auf den fundamentalen Punkt hinzuweisen, der die beiden unterscheidet: Der Zweck privater Medien ist es letztlich, für ihre Eigentümer*innen Geld zu verdienen. Die öffentlich-rechtlichen hingegen bindet ihr gesetzlicher Informationsauftrag, so muss der ORF laut Gesetz „[…] umfassende Information der Allgemeinheit über alle wichtigen politischen, sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und sportlichen Fragen“ und „Förderung des Verständnisses für alle Fragen des demokratischen Zusammenlebens“ gewährleisten.
Der ORF ist – bei aller berechtigten Kritik – eine wesentliche Säule des öffentlichen Diskurses. Seine Radio- und Fernsehsender, ebenso die „blaue Seite“, werden von gewissenhaften Journalist*innen zu einer wesentlichen Quelle seriöser Information gestaltet, die Millionen Österreicher*innen jeden Tag nützen und der sie vertrauen.
Ein anderes Beispiel für ein verlässliches und hochqualitatives Medium ist die „Wiener Zeitung“. Sie erscheint seit über 300 Jahren beinahe ununterbrochen und hat sich gerade in den letzten Jahren zu einem absoluten Qualitätsblatt entwickelt. Da sie im Eigentum der Republik steht und bisher durch Pflichtveröffentlichungen (mit-)finanziert wurde, war sie nie dem großen wirtschaftlichen Druck ausgesetzt, der in Österreich und weltweit zu einem Kahlschlag bei den Tageszeitungen geführt hat. Jetzt hat die Bundesregierung ihre Einstellung angekündigt.
Dass die Lage der Tageszeitungen, der Printmedien generell, in Österreich nicht gerade rosig ist, zeigt der Vergleich: In der deutschsprachigen Schweiz existieren dreimal so viele Tageszeitungen wie hierzulande, bei einem Bruchteil der Einwohner*innen[1]. Der wirtschaftliche Druck auf Journalist*innen, gerade auch Jungjournalist*innen ist enorm, da die Einkommen niedrig und die Arbeitsplätze generell prekär sind. Die „Wiener Zeitung“ bildet hier eine Ausnahme, ihr von der Regierung geplantes Ende bereitet Sorge.
Zu häufig und oft allzu leichtfertig führen wir in Österreich einen Diskurs darüber, wie schlecht der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei, wie teuer er uns alle komme und dass es an der Zeit sei, die Gebühren oder gleich den ganzen ORF abzuschaffen. Zu den häufigen Volksbegehren gegen die Rundfunkgebühren kommen die Angriffe auf die „Wiener Zeitung“.
Wir sind uns in der Sozialdemokratie einig, dass eine demokratische Republik ein ureigenes Interesse an einer aufgeklärten und informierten Bevölkerung und einem politischen Diskurs auf Augenhöhe hat. Die Information der Öffentlichkeit den profitorientierten Privaten zur Gänze zu überlassen wäre fatal.
Die SPÖ Wien steht für eine breite und diverse Medienlandschaft, in der öffentliche und private Medien gleichermaßen ihren Platz haben. Unsere besondere Fürsorge gilt jedoch den öffentlich-rechtlichen Angeboten, denn sie sind für den Bestand unserer Demokratie unerlässlich.
[1] Politico.eu, „The Austrian newspaper that can survive anything … except Sebastian Kurz?“ (Online: 24.10.2022)

Der Kern des demokratischen Anspruchs ist für uns: Wer von Gesetzen betroffen ist, muss bei ihrer Entstehung mitreden können. Doch auch abgesehen davon bringt es eine Gesellschaft konkret voran, wenn sie von allen mitgestaltet wird. Durch die Teilnahme an demokratischen Prozessen lernen Menschen, gemeinsam Entscheidungen zu treffen und Verantwortung füreinander zu übernehmen.
Im derzeitigen Recht bestimmt aber ausschließlich die Staatsbürger*innenschaft, wer in Österreich die Gesellschaft mitgestalten darf: Wählen, abstimmen und kandidieren dürfen in fast allen Fällen nur österreichische Staatsbürger*innen. Von einem allgemeinen Wahlrecht kann in Österreich keine Rede sein.
Das österreichische Staatsbürger*innenschaftsgesetz orientiert sich am „Ius Sanguinis“, dem Abstammungsprinzip. Staatsbürger*innenschaft wird damit großteils vererbt. Dem gegenüber steht das „Ius Soli“, das Geburtsortprinzip: Wer innerhalb eines Landes geboren wird, bekommt automatisch die Staatsbürger*innenschaft. In der Realität ist dieser Unterschied nicht binär, es geht um Zwischenlösungen – und Österreich orientiert sich dabei klar am Abstammungsprinzip.
Weil das Wahlrecht an die Staatsbürger*innenschaft gekoppelt ist, wird so rund 1,4 Millionen Menschen in ihrer Heimat das Wahlrecht verwehrt – das sind 18 Prozent der Menschen im wahlfähigen Alter[1]. In Wien ist die Situation noch dramatischer: Über 540.000 Personen, 32 Prozent der Wohnbevölkerung, dürfen nicht wählen. Davon leben 80 Prozent seit über fünf Jahren in Österreich, 53 Prozent sogar über zehn Jahre[2]. Wie bereits ausgeführt, betrifft das besonders oft Arbeiter*innen und junge Menschen. Das bedeutet auch: Da die Mandate für den Nationalrat an die Zahl der Wahlberechtigten und nicht an die Bevölkerungszahl gebunden sind, verlieren die Interessen der Wiener Bevölkerung politisches Gewicht in bundesweiten Organen.
Das Problem vergrößert sich laufend. Die Wohnbevölkerung steigt, die wahlberechtigte Bevölkerung geht zurück. Bei der Bundespräsidentenwahl durften 4.000 Menschen weniger abstimmen als bei der letzten Nationalratswahl 2019. Tatsächlich eingebürgert werden jährlich im Schnitt etwa 8.000 bis 10.000 Personen. Letztes Jahr waren es 16.171, wegen des nun vereinfachten Zugangs von Nachkommen von Verfolgten des Nationalsozialismus.[3] Diese Zahl steht in keinem Verhältnis zu den 1,4 Millionen Nicht-Wahlberechtigten.
Hier wird das Kernproblem deutlich: Man schließt einen großen Anteil der betroffenen Menschen aus, weil das Wahlrecht an die österreichische Staatsbürger*innenschaft gekoppelt ist (nur auf Bezirksebene dürfen EU-Bürger*innen wählen), während gleichzeitig zugewanderten Menschen hohe Hürden zur Einbürgerung gesetzt werden. Das geht in Richtung Zensuswahlrecht.
Problematisch ist dieser Ausschluss großer Teile der Bevölkerung von der demokratischen Mitbestimmung, weil es unserem Bild von sozialer Demokratie widerspricht, weil es sozial schädlich ist, und weil es für die Einbürgerung willkürliche Hürden gibt.
Einzelpersonen müssen ein Einkommen von 1.030,49 Euro vorweisen, Ehepaare 1.625,71 Euro (Stand 2022)[4] – und zwar abzüglich regelmäßiger Belastungen wie Miete, Betriebskosten, Strom- und Gaskosten, Unterhaltszahlungen und weitere. Das übersteigt deutlich den Lohn nach Kollektivvertrag in vielen Branchen. Die zweite finanzielle Hürde sind die Antragsgebühren selbst. Je nach Einkommen und Bundesland addieren sich Bundes- und Ländergebühren auf 1.080 bis 2.350 Euro[5]. Dazu kommen oft versteckte Kosten, etwa für Übersetzungen und Urkunden-Beglaubigungen.
Das trifft Frauen besonders, da sie öfter von Armut betroffen und bedroht sind – und natürlich Arbeiter*innen, wie bereits dargelegt.
Das bedeutet: Unter den Menschen ohne Wahlrecht werden die finanziell Schwächsten, die am schlimmsten unter den bestehenden Verhältnissen leiden, an der Mitgestaltung dieser Verhältnisse am stärksten gehindert. Das bedroht den sozialen Zusammenhalt und die demokratische Legitimität.
Zu diesen finanziellen Hürden kommt die lange Mindestaufenthaltsdauer: Zehn Jahre sind die Norm, sechs Jahre die Ausnahme, bei Unterbrechungen beginnt die Frist meist von vorn. In den meisten anderen Ländern Europas sind diese Voraussetzungen niedriger und damit gerechter.[6] So hat etwa die deutsche Bundesregierung 2021 im Koalitionsabkommen vereinbart, Einbürgerungen bereits nach fünf Jahren zu ermöglichen, bei besonderen Integrationsleistungen nach nur drei Jahren; in Deutschland geborene Kinder werden automatisch Deutsche, sofern ein Elternteil seit mindestens fünf Jahren in Deutschland lebt.
Weitere Hürden stellen zu hohe Anforderungen an die Wohnsituation dar, die über durchschnittliche und leistbare Wohnungsgrößen hinausgehen; auch der Sprachnachweis, den sogar Menschen zu erbringen haben, die in Österreich ein Studium absolviert haben, wird viel zu unflexibel gehandhabt.
Und selbst wenn man all diese willkürlichen Voraussetzungen erfüllt, muss man sich bei den Behörden einem oftmals abschreckenden Verfahren unterziehen: Immense Dokumentmengen werden verlangt, dazu Sprachnachweise und Geschichtsprüfungen. Hinzu kommen lange Wartezeiten, bedingt durch die unzureichenden Kapazitäten der Behörden und wiederholte Änderungen im Verfahrensablauf durch den Bundesgesetzgeber. Die Staatsbürger*innenschaft zu erwerben, soll ein einladender und wertschätzender Prozess sein, der die Würde der Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Der heutige Zustand wirkt in höchstem Maße desintegrativ. Wer von der Mitbestimmung ausgeschlossen wird, empfindet weniger Verantwortungsgefühl. Im Umkehrschluss wäre ein erleichterter Zugang zur Staatsbürger*innenschaft ein integratives Werkzeug. Wenn man mitgestalten kann, wenn man gefragt und gehört wird, übernimmt man Verantwortung für die Zukunft einer Gesellschaft. Und ein Gemeinwesen, in dem alle mehr Verantwortung füreinander übernehmen, ist exakt das Ziel einer sozialdemokratischen Bewegung.
Um die Debatte über eine Lösung dieses Problems zu rationalisieren, hilft eine internationale Perspektive. Anderswo ist die Staatsbürger*innenschaft kein „hohes“, sondern einfach nur ein Wirtschaftsgut. Es hat keinen emotionalen Wert, sondern einen finanziellen. Denn viele Staaten bieten sogenannte „Citizenship-by-Investment“-Programme: Wer Geld ins Land spült, bekommt dafür die Staatsbürger*innenschaft mit allen damit verbundenen Vorteilen. Es gibt eigene Rating-Agenturen, die Staatsbürger*innenschaften nach Wert für Investor*innen bewerten.[7] Auch das ist undemokratisch und unsozial und daher keine Lösung, die wir anstreben.
Österreich muss also dringend sein Staatsbürger*innenschaftsrecht reformieren. Die Änderung muss sich am Ius Soli-Prinzip orientieren. Sie hat diejenigen Einkommen als ausreichend zu erachten, die die Kollektivverträge vorsehen, sie hat auf die durchschnittlichen Wohnverhältnisse abzustellen, sie hat jegliche unsinnige Verkomplizierung und jegliche Schikane zu vermeiden.
Wer den Mittelpunkt der Lebensinteressen in Österreich hat, soll die Chance haben, Staatsbürger*in zu werden. Staatsbürger*innenschaft, und damit Mitbestimmung, darf kein Privileg der Abstammung sein, und keines der Reichen. Der Mindestaufenthalt soll fünf Jahre betragen, was sowohl dem System des österreichischem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes als auch dem EU-Recht für die Rechtsstellung von „langfristig Aufenthaltsberechtigten“ entspricht. Das Kriterium soll die Aufenthaltsverfestigung sein und das klare Ziel, sich Österreich auch als Staatsbürger*in anzuschließen.
[1] Statistik Austria in NEWS Nr. 38/2022
[2] Wiener Integrationsmonitor (2020)
[3] Statistik Austria (2022)
[4] oesterreich.gv.at (2022)
[5] Profil.at, „Einbürgerungen bis zu 130 Prozent teurer als Plakolm behauptet“ (Online: 24.10.2022)
[6] Valchars, Gerd; Bauböck, Rainer. „Migration und Staatsbürgerschaft“ (2021)
[7] goldenvisas.com (Online: 24.10.2022)

Theoretisch wäre eine Entkopplung des Wahlrechts von der Staatsbürger*innenschaft – durch eine verfassungsgebende Mehrheit – denkbar. Wir aber entscheiden uns bewusst für den Weg der Staatsbürger*innenschaftsrechts-Reform. Denn ein gerechterer Zugang zur Staatsbürger*innenschaft ermöglicht nicht nur mehr Menschen die Mitbestimmung, sondern bringt auch ökonomische Perspektiven, stabilere Arbeitsverhältnisse, höhere Bildungschancen und ist nicht zuletzt ein symbolischer Akt der Gemeinschaft.
Doch neben den Wahlen zu gesetzgebenden Organen gibt es einen Bereich, in dem eine Wahlrechtsreform durchführbar und sinnvoll wäre. Auf Kommunalebene können schon jetzt EU-Bürger*innen wählen – damit ist ein kommunales Wahlrecht für nicht-österreichische Staatsbürger*innen verfassungsrechtlich bereits akzeptiert. Ein gangbarer nächster Schritt wäre eine weitere Öffnung dieses Wahlrechts für die Wohnbevölkerung. In 14 EU-Staaten ist das bereits umgesetzt.[1]
Die SPÖ Wien hat eine solche Reform des Gemeindewahlrechts bereits 2002 beschlossen. Zwei Jahre später hob es der Bundesverfassungsgerichtshof auf, mit der Begründung, es verletze das Prinzip eines homogenen Wahlrechts: Nur Österreicher*innen dürfe es zukommen. Allerdings war bereits das Kommunalwahlrecht für EU-Bürger*innen eine Ausnahme zu diesem Prinzip (erstmals wählen konnten sie bei der Bezirksvertretungswahl 1996), das dementsprechend nicht unumstößlich sein kann.
Hinzukommt, dass sich die Situation seit damals drastisch geändert hat. Die Wiener Wohnbevölkerung ist heute so zusammengesetzt, dass in einigen Bezirken unter Berücksichtigung der Nicht-Wähler*innen und der nicht-wahlberechtigten Bevölkerung im wahlfähigen Alter nur eine Minderheit wählt, was dem demokratischen Prinzip widerspricht.
Dabei geht es in der kommunalen Politik um die direkte Lebensrealität der Menschen. Hier entscheidet sich, durch welche Umgebung man sich täglich bewegt, wo die Kinder spielen, ob man seine Zeit gerne in der eigenen Nachbarschaft verbringt.
Daher streben wir eine Öffnung des kommunalen Wahlrechts für nicht-österreichische Staatsbürger*innen an. Dies würde der Staatsbürger*innenschafts-Reform nicht zuwiderlaufen
Falls Letztere aus unterschiedlichen Gründen nicht umsetzbar sein sollte, wäre auch eine Wahlrechtsreform für gesetzgebende Körperschaften denkbar.
[1] Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestags (2018)

Auch landesweite Volksabstimmungen, Volksbegehren, Petitionen und Bürger*inneninitiativen erfordern die österreichische Staatsbürger*innenschaft, und schließen damit ebenfalls 18 Prozent der Menschen, die hier leben und arbeiten, aus.
Dieser „zweite Pfeiler der Demokratie“ erlaubt die Mitbestimmung zu einzelnen Themen und zu selbstbestimmten Zeitpunkten. Das erweitert die Möglichkeiten, sich aktiv und direkt in die gesellschaftliche Gestaltung einzubringen. Darum gilt: Zur Verwirklichung der Demokratie auf der Höhe der Zeit bedarf es neben einem modernen Wahlrecht der wesensgemäßen Ausgestaltung des Initiativ- und Abstimmungsrechtes der Staatsbürger*innen.
In der österreichischen Verfassung finden sich bereits solche Instrumente. Neben den regelmäßig stattfindenden Wahlen, durch welche die repräsentativen Organe der Gesetzgebung gebildet werden, kann das Parlament durch Volksbegehren und Petitionen dazu verpflichtet werden, sich mit einer Sache auseinanderzusetzen – abgesehen vom legislativen Aspekt ist dies ein wichtiges Instrument, um mediale Aufmerksamkeit auf Themen zu lenken, die eine große Zahl an Menschen bewegen. Auch auf der europäischen Ebene existiert ein solches Instrument: Die Europäische Bürgerinitiative, mit der die EU-Kommission aufgefordert werden kann, sich mit einer Sache zu befassen.
Außerdem finden Volksabstimmungen statt, wenn dies parlamentarisch beschlossen wurde, oder sie sind „obligatorisch“, wenn eine „Gesamtänderung der Verfassung" vorliegt.
In all diesen Fällen kann jedoch nur über bereits parlamentarisch Beschlossenes entschieden werden. Nicht möglich sind Volksentscheide, wenn die Vorschläge der Volksbegehren parlamentarisch nicht beschlossen wurden.
Hier erkennen wir Modernisierungsbedarf. In Wien wird er bereits angepackt. Das städtische Petitionsrecht ermöglicht Personen jedweder Staatsbürger*innenschaft ab 16 Jahren, sich direkt in den politischen Prozess einzubringen. Mit der aktuellen Novelle dieses Rechts werden Initiator*innen von Petitionen ab Januar 2023 persönlich in den Petitionsausschuss eingeladen, wo sie ihre Ideen präsentieren und diskutieren können.
Eine immer größere Rolle spielen Möglichkeiten der digitalen Partizipation: Prozesse wie Abstimmungen, Petitionen oder das Ausarbeiten von kommunalen Projekten können online stattfinden, was die Einstiegshürde senkt und inklusiv wirken kann. Damit sind allerdings Risiken verbunden. Die scheinbare Inklusion kann vom Digital Gap konterkariert werden: Zugang zu digitalen Technologien hat eigene Hürden, etwa den Bildungsgrad oder finanzielle Ressourcen zum Kauf von Endgeräten[1]. Außerdem sind digitale Prozesse anfällig für Cyber-Sabotage. Aus diesen Gründen ist es wichtig, Instrumente der digitalen Partizipation aktiv, aber achtsam weiterzuentwickeln.
Um den zweiten Pfeiler der Demokratie insgesamt zu verbessern, verpflichten wir uns zu einem tieferen Diskurs mit dem Ziel, Instrumente der direkten politischen Willensbildung an unseren Anspruch einer modernen Demokratie anzupassen.
[1] Keller, Loraine. "Digital Participation or Digital Divide?“ (2022)
Abrahamczik Nina
Ackerl Alexander
Akcay Safak
Auer-Stüger Stephan
Baxant Peko
Bayr Petra
Berger-Krotsch Nicole
Czernohorszky Jürgen
Erdost Ilkim
Florianschütz Peter
Grimling Elisabeth
Grüll Philipp
Hadrani Akim
Halkic Sabrina
Herzog Bernhard
Höferl Andreas
Hoffmann Aline
Kienesberger Michael
Kowall Nikolaus
Lehner Daniel
Marichici Maria
Matzka Manfred
Novak Barbara
Ngosso Mireille
Obrecht Sascha
Papai Georg
Raschek Patricia
Schennach Stefan
Schiel Bernhard
Seitner Johannes
Stürzenbecher Kurt
Taucher Josef
Toumi Rihab
Vasold Stefanie
Wenty Ditmar
Yilmaz Nurten
Junge Generation Wien
Sozialistische Jugend Wien
SPÖ Bezirksorganisation Leopoldstadt
SPÖ Bezirksorganisation Alsergrund
SPÖ Bezirksorganisation Wieden
Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Wien
Verband sozialistischer Student_innen Wien